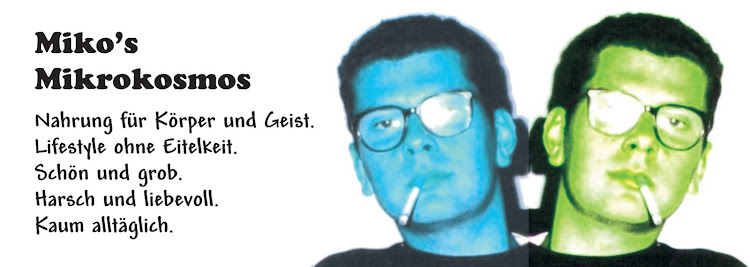Das Jahr des Herrn 2011 ist zu
Ende und bietet sich sogleich auch als Objekt einer kurzen Rückschau an. Nun,
die TV-Anstalten taten ohnehin alles, um eine Chronologie des Wahnsinns Revue
passieren zu lassen. Es erübrigt sich daher, dem eine weitere Fußnote
hinzuzufügen. Was 2011 als durchaus interessantes und lehrreiches Jahr
erscheinen lässt, mag dennoch kurz zusammengefasst werden. Dauerbrenner war das
liebe Geld, das in gasförmiger Form dem lieben Santa Claus im Schornstein
entgegenkam. Dem gegenüber stand eine wahre Orgie des Blutvergießens. Was aber
kaum noch jemanden schockiert hat. Der Blick aufs Bankkonto ließ keine Zeit für
so härene Gefühle wie Mitleid oder Trauer. Ja in Zeiten, wo der Anstand von der
Woge des Zeitgeists über Bord gespült wird, hat nichts mehr Gültigkeit. Einzig
der klare Trend zur Radikalisierung in weiten Teilen der Welt. Tea-Party in den
USA, Steinzeitkommunismus in Nordkorea, Islamismus beinahe allerorten. Dazu
Raubtierkapitalismus, die Vernichtung Afrikas und eine Tragödie, in die sich
Europa selbst hineinmanövriert. Durch immer weniger Bildung und immer mehr
unsinniger Technologie, die Menschen dazu bringt, ihr Gehirn endgültig
abzuschalten. Ganz zu schweigen von einer linken Protest(un)kultur, die jeglichen
Respekt verloren hat und der rechten Antwort darauf. Siehe Breivik und NSU. Es
ist müßig all das aufzuzählen, was 2011 passiert ist, weil dieses Jahr nur in
einer Reihe von Jahren steht, die uns wieder zurück auf Null bringen wird.
Oder glaubt jemand ernsthaft noch an das, was man sich in Durban zum Ziel
gesetzt hat? Wir werden vor die Hunde gehen. Das ist mittlerweile beschlossene
Sache. Daran kann weder ein grüner Protestphantast noch der engagierte Manager
etwas ändern. China steht erst am Anfang einer Industrialisierung, der wir
letztlich alle zum Opfer fallen werden. Noch bevor sich Osama Bin Ladens
Wahntheorien realisiert haben. Oder der Iran uns die Atombombe auf den Kopf
schmeißt. In diesem Sinne – ein glückliches neues Jahr!
Das Jahr des Herrn 2011 ist zu
Ende und bietet sich sogleich auch als Objekt einer kurzen Rückschau an. Nun,
die TV-Anstalten taten ohnehin alles, um eine Chronologie des Wahnsinns Revue
passieren zu lassen. Es erübrigt sich daher, dem eine weitere Fußnote
hinzuzufügen. Was 2011 als durchaus interessantes und lehrreiches Jahr
erscheinen lässt, mag dennoch kurz zusammengefasst werden. Dauerbrenner war das
liebe Geld, das in gasförmiger Form dem lieben Santa Claus im Schornstein
entgegenkam. Dem gegenüber stand eine wahre Orgie des Blutvergießens. Was aber
kaum noch jemanden schockiert hat. Der Blick aufs Bankkonto ließ keine Zeit für
so härene Gefühle wie Mitleid oder Trauer. Ja in Zeiten, wo der Anstand von der
Woge des Zeitgeists über Bord gespült wird, hat nichts mehr Gültigkeit. Einzig
der klare Trend zur Radikalisierung in weiten Teilen der Welt. Tea-Party in den
USA, Steinzeitkommunismus in Nordkorea, Islamismus beinahe allerorten. Dazu
Raubtierkapitalismus, die Vernichtung Afrikas und eine Tragödie, in die sich
Europa selbst hineinmanövriert. Durch immer weniger Bildung und immer mehr
unsinniger Technologie, die Menschen dazu bringt, ihr Gehirn endgültig
abzuschalten. Ganz zu schweigen von einer linken Protest(un)kultur, die jeglichen
Respekt verloren hat und der rechten Antwort darauf. Siehe Breivik und NSU. Es
ist müßig all das aufzuzählen, was 2011 passiert ist, weil dieses Jahr nur in
einer Reihe von Jahren steht, die uns wieder zurück auf Null bringen wird.
Oder glaubt jemand ernsthaft noch an das, was man sich in Durban zum Ziel
gesetzt hat? Wir werden vor die Hunde gehen. Das ist mittlerweile beschlossene
Sache. Daran kann weder ein grüner Protestphantast noch der engagierte Manager
etwas ändern. China steht erst am Anfang einer Industrialisierung, der wir
letztlich alle zum Opfer fallen werden. Noch bevor sich Osama Bin Ladens
Wahntheorien realisiert haben. Oder der Iran uns die Atombombe auf den Kopf
schmeißt. In diesem Sinne – ein glückliches neues Jahr!Samstag, 31. Dezember 2011
A. D. 2011
 Das Jahr des Herrn 2011 ist zu
Ende und bietet sich sogleich auch als Objekt einer kurzen Rückschau an. Nun,
die TV-Anstalten taten ohnehin alles, um eine Chronologie des Wahnsinns Revue
passieren zu lassen. Es erübrigt sich daher, dem eine weitere Fußnote
hinzuzufügen. Was 2011 als durchaus interessantes und lehrreiches Jahr
erscheinen lässt, mag dennoch kurz zusammengefasst werden. Dauerbrenner war das
liebe Geld, das in gasförmiger Form dem lieben Santa Claus im Schornstein
entgegenkam. Dem gegenüber stand eine wahre Orgie des Blutvergießens. Was aber
kaum noch jemanden schockiert hat. Der Blick aufs Bankkonto ließ keine Zeit für
so härene Gefühle wie Mitleid oder Trauer. Ja in Zeiten, wo der Anstand von der
Woge des Zeitgeists über Bord gespült wird, hat nichts mehr Gültigkeit. Einzig
der klare Trend zur Radikalisierung in weiten Teilen der Welt. Tea-Party in den
USA, Steinzeitkommunismus in Nordkorea, Islamismus beinahe allerorten. Dazu
Raubtierkapitalismus, die Vernichtung Afrikas und eine Tragödie, in die sich
Europa selbst hineinmanövriert. Durch immer weniger Bildung und immer mehr
unsinniger Technologie, die Menschen dazu bringt, ihr Gehirn endgültig
abzuschalten. Ganz zu schweigen von einer linken Protest(un)kultur, die jeglichen
Respekt verloren hat und der rechten Antwort darauf. Siehe Breivik und NSU. Es
ist müßig all das aufzuzählen, was 2011 passiert ist, weil dieses Jahr nur in
einer Reihe von Jahren steht, die uns wieder zurück auf Null bringen wird.
Oder glaubt jemand ernsthaft noch an das, was man sich in Durban zum Ziel
gesetzt hat? Wir werden vor die Hunde gehen. Das ist mittlerweile beschlossene
Sache. Daran kann weder ein grüner Protestphantast noch der engagierte Manager
etwas ändern. China steht erst am Anfang einer Industrialisierung, der wir
letztlich alle zum Opfer fallen werden. Noch bevor sich Osama Bin Ladens
Wahntheorien realisiert haben. Oder der Iran uns die Atombombe auf den Kopf
schmeißt. In diesem Sinne – ein glückliches neues Jahr!
Das Jahr des Herrn 2011 ist zu
Ende und bietet sich sogleich auch als Objekt einer kurzen Rückschau an. Nun,
die TV-Anstalten taten ohnehin alles, um eine Chronologie des Wahnsinns Revue
passieren zu lassen. Es erübrigt sich daher, dem eine weitere Fußnote
hinzuzufügen. Was 2011 als durchaus interessantes und lehrreiches Jahr
erscheinen lässt, mag dennoch kurz zusammengefasst werden. Dauerbrenner war das
liebe Geld, das in gasförmiger Form dem lieben Santa Claus im Schornstein
entgegenkam. Dem gegenüber stand eine wahre Orgie des Blutvergießens. Was aber
kaum noch jemanden schockiert hat. Der Blick aufs Bankkonto ließ keine Zeit für
so härene Gefühle wie Mitleid oder Trauer. Ja in Zeiten, wo der Anstand von der
Woge des Zeitgeists über Bord gespült wird, hat nichts mehr Gültigkeit. Einzig
der klare Trend zur Radikalisierung in weiten Teilen der Welt. Tea-Party in den
USA, Steinzeitkommunismus in Nordkorea, Islamismus beinahe allerorten. Dazu
Raubtierkapitalismus, die Vernichtung Afrikas und eine Tragödie, in die sich
Europa selbst hineinmanövriert. Durch immer weniger Bildung und immer mehr
unsinniger Technologie, die Menschen dazu bringt, ihr Gehirn endgültig
abzuschalten. Ganz zu schweigen von einer linken Protest(un)kultur, die jeglichen
Respekt verloren hat und der rechten Antwort darauf. Siehe Breivik und NSU. Es
ist müßig all das aufzuzählen, was 2011 passiert ist, weil dieses Jahr nur in
einer Reihe von Jahren steht, die uns wieder zurück auf Null bringen wird.
Oder glaubt jemand ernsthaft noch an das, was man sich in Durban zum Ziel
gesetzt hat? Wir werden vor die Hunde gehen. Das ist mittlerweile beschlossene
Sache. Daran kann weder ein grüner Protestphantast noch der engagierte Manager
etwas ändern. China steht erst am Anfang einer Industrialisierung, der wir
letztlich alle zum Opfer fallen werden. Noch bevor sich Osama Bin Ladens
Wahntheorien realisiert haben. Oder der Iran uns die Atombombe auf den Kopf
schmeißt. In diesem Sinne – ein glückliches neues Jahr!Mittwoch, 30. November 2011
Völkerball
Freitag, 21. Oktober 2011
Lockerbie
Mittwoch, 5. Oktober 2011
Tag der Einheit
Dienstag, 6. September 2011
Apokalypto
Die Handlung des in einer alten Mayasprache vertonten Streifens ist schnell erzählt. Kurz vor Ankunft der ersten spanischen Konquistadoren um 1500 lebt der Jäger „Pranke des Jaguar“ mit seiner Familie in einem kleinen Dorf im mittelamerikanischen Regenwald. Das archäische Leben wird jäh gestört, als ein Trupp Menschenjäger die Siedlung heimsucht und die Bewohner entweder tötet oder gefangen nimmt. Dem Helden der Geschichte gelingt es, Frau und Kind in Sicherheit zu bringen, ehe er sich in einer aneinander gebundenen Sklavenkarawane wiederfindet. „Leitwolf“, der Anführer der Menschenhändler, verschleppt die Gefangenen in eine große Maya-Stadt, wo sie dem Sonnengott geopfert werden sollen. Auf dem beschwerlichen Weg dorthin, vorbei an einer geschundenen, ausgebeuteten Natur, wird „Leitwolf“ und seinen Leuten eine düstere Prophezeiung zuteil, die sich bis zum Ende der Handlung Stück für Stück erfüllt. In der Metropole angekommen, offenbart sich ein Bild des Schreckens. Ein Hohepriester opfert, an der Spitze einer Pyramide stehend, im Minutentakt Menschen und stößt die toten Leiber die steilen Stufen hinab. Die letzte Stunde von „Pranke des Jaguar“ scheint heran gebrochen, doch als er mit blauer Farbe beschmiert auf den Opfertisch gelegt wird, verfinstert sich die Sonne, um kurz darauf wieder zu erscheinen. Dies wird als Zeichen dafür gedeutet, dass genug Blut geflossen ist und die Götter besänftigt sind. „Leitwolf“ ist darüber keineswegs erfreut und führt seine Gefangenen zu einem rituellen Ballspielplatz, wo sie nacheinander mit Speeren getötet werden. „Pranke des Jaguar“ kann durch Zufall entkommen und flieht zurück in den Dschungel. Es beginnt eine mörderische Jagd, der nach und nach alle Häscher zum Opfer fallen. Letztlich endet die Hatz an einem idyllischen Strand, wo gerade spanische Schiffe vor Anker gehen, was den endgültigen Niedergang der Hochkultur der Maya manifestiert. „Pranke des Jaguar“ findet Frau und Kind und verschwindet auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen des Urwalds.
Kritiker führen an, dass die verwendete Sprache linguistisch nicht einwandfrei ist. Zudem habe es bei den Mayas kein Massenschlachten von Menschen gegeben. Vielmehr wären Blutopfer Teil eines komplexen religiösen Rituals gewesen. Ja, manch einer verstieg sich sogar dazu, den Film als rassistisch zu bezeichnen. Seriös betrachtet handelt es sich bei „Apokalypto“ um einen Film mit jeder Menge Zivilisationskritik. Übervölkerte Städte, Monokulturen, Raubbau, Hungersnöte, Seuchen. Bildgeladen, emotional, anmutig. Diese Adjektive beschreiben das vom „New Yorker“ als pathologisches Kunstwerk bezeichnete Epos über eine dem Untergang geweihte Zivilisation wohl am besten. Unbedingt sehenswert.
Freitag, 29. Juli 2011
Humanismus oder Gutmenschentum
Sonntag, 5. Juni 2011
Aufstieg zum Mont Ventoux
 Der Aufstieg der Aufstiege. Der große Steinhaufen inmitten der Provence. Der kahle Berg. Und Armstrong hat es 2009 allen Unkenrufern nochmals gezeigt. Doch mit dem Mont Ventoux ist auch eine andere, weitaus bittere Geschichte verbunden. 1967 kam der ehemalige Straßenweltmeister Tom Simpson kurz vor der Gipfelpassage zu Tode. Fiel einfach vom Rad. Nach tagelanger Einnahme von Amphetaminen. Gemischt mit jeder Menge Schnaps. Zu Zeiten, wo Doping noch nicht geächtet war. Wo sich die Fahrer während des Rennens noch Stimulationsspritzen setzten. Erst Jahre später kam es zum Umdenken. Und seitdem steht der Radsport an erster Stelle bei den Dopingfahndern. Eine ganze Sportart in Geiselhaft der Moralapostel. Nirgends sonst wird so hart und rigide kontrolliert wie bei den Helden der Landstraße. Und dadurch werden auch immer wieder Sünder entlarvt. Mit dem Ergebnis, daß Sendeanstalten ihre Berichterstattung aufgaben oder stark einschränkten. Der Radsport steht am Pranger. Als willfähriges Bauernopfer. Die Sportler werden verfolgt. In Italien sogar gejagt. Man würde sich wünschen, daß die dortige Justiz einen solchen Eifer bei der Ermittlung gegen das organisierte Verbrechen an den Tag legen würde. Oder gegen einen Ministerpräsidenten, der jeden Widerspruch im Keim ersticken läßt. Stattdessen durfte der Spanier Valverde bei einer der letzten Tour de France Austragungen nicht teilnehmen, weil sie ein paar Kilometer auch auf italienischen Boden führte. Und er dort zur Persona non grata erklärt wurde. Der Staatsbesuch vom libyschen Revolutionsführer Gadaffi stellte dagegen kein moralisches Problem dar. Lang lebe die Scheinheiligkeit! Doch hält man sich die Bilder der letzten Tage vor Augen, erkennt man, wie populär dieser Sport nach wie vor bei den Menschen ist. Mit welchem Fanatismus die Massen ihre Helden anfeuern. Unweigerlich kommen die Erinnerungen an alte Tage zurück. An die Auftritte von Hinault, Indurain oder Pantani. Den Protagonisten der führenden Radsportnationen vor der Ära des Texaners Lance Armstrong. Doping wird es im Leistungssport immer geben. Damit muß man sich als geneigter Zuschauer abfinden. Wie sonst sind die schier grenzenlosen Erfolge der Chinesen bei ihren Heimspielen 2008 zu erklären? Doch nur deshalb, weil sie den Fahndern immer einen Schritt voraus waren. Und sich an Experimente a la Gendoping heranwagten. Nun, wenn man bedenkt, was ein Menschenleben in der Volksrepublik wert ist. Nur hat da niemand Zeter und Mordio geschrieen. Haben keine Sender ihre Berichterstattung abgebrochen. The show must go on. Vor allem, wenn man was für den eigenen Seelenfrieden getan hat. Sich ein Alibi verschaffte. Indem man den Radsport in die Pfanne gehaut hat.
Der Aufstieg der Aufstiege. Der große Steinhaufen inmitten der Provence. Der kahle Berg. Und Armstrong hat es 2009 allen Unkenrufern nochmals gezeigt. Doch mit dem Mont Ventoux ist auch eine andere, weitaus bittere Geschichte verbunden. 1967 kam der ehemalige Straßenweltmeister Tom Simpson kurz vor der Gipfelpassage zu Tode. Fiel einfach vom Rad. Nach tagelanger Einnahme von Amphetaminen. Gemischt mit jeder Menge Schnaps. Zu Zeiten, wo Doping noch nicht geächtet war. Wo sich die Fahrer während des Rennens noch Stimulationsspritzen setzten. Erst Jahre später kam es zum Umdenken. Und seitdem steht der Radsport an erster Stelle bei den Dopingfahndern. Eine ganze Sportart in Geiselhaft der Moralapostel. Nirgends sonst wird so hart und rigide kontrolliert wie bei den Helden der Landstraße. Und dadurch werden auch immer wieder Sünder entlarvt. Mit dem Ergebnis, daß Sendeanstalten ihre Berichterstattung aufgaben oder stark einschränkten. Der Radsport steht am Pranger. Als willfähriges Bauernopfer. Die Sportler werden verfolgt. In Italien sogar gejagt. Man würde sich wünschen, daß die dortige Justiz einen solchen Eifer bei der Ermittlung gegen das organisierte Verbrechen an den Tag legen würde. Oder gegen einen Ministerpräsidenten, der jeden Widerspruch im Keim ersticken läßt. Stattdessen durfte der Spanier Valverde bei einer der letzten Tour de France Austragungen nicht teilnehmen, weil sie ein paar Kilometer auch auf italienischen Boden führte. Und er dort zur Persona non grata erklärt wurde. Der Staatsbesuch vom libyschen Revolutionsführer Gadaffi stellte dagegen kein moralisches Problem dar. Lang lebe die Scheinheiligkeit! Doch hält man sich die Bilder der letzten Tage vor Augen, erkennt man, wie populär dieser Sport nach wie vor bei den Menschen ist. Mit welchem Fanatismus die Massen ihre Helden anfeuern. Unweigerlich kommen die Erinnerungen an alte Tage zurück. An die Auftritte von Hinault, Indurain oder Pantani. Den Protagonisten der führenden Radsportnationen vor der Ära des Texaners Lance Armstrong. Doping wird es im Leistungssport immer geben. Damit muß man sich als geneigter Zuschauer abfinden. Wie sonst sind die schier grenzenlosen Erfolge der Chinesen bei ihren Heimspielen 2008 zu erklären? Doch nur deshalb, weil sie den Fahndern immer einen Schritt voraus waren. Und sich an Experimente a la Gendoping heranwagten. Nun, wenn man bedenkt, was ein Menschenleben in der Volksrepublik wert ist. Nur hat da niemand Zeter und Mordio geschrieen. Haben keine Sender ihre Berichterstattung abgebrochen. The show must go on. Vor allem, wenn man was für den eigenen Seelenfrieden getan hat. Sich ein Alibi verschaffte. Indem man den Radsport in die Pfanne gehaut hat.Donnerstag, 2. Juni 2011
Verschwörungstheorie Mondlandung
Donnerstag, 21. April 2011
Der NATO-Doppelbeschluss
Donnerstag, 14. April 2011
Quo vadis, Hellas?
 Nun, wer schätzt es nicht, das Land an den Gestaden der Ägäis? Die Heimat von Platon, Homer und Sokrates. Die Wirkstätte der Spartaner, Minoer und Makedonier. Das Füllhorn aller Mythologie, die Geburtsstätte der Demokratie und der Olympischen Spiele. Wer mag ihn nicht, den Wein, den Feta, die Oliven? Griechenland ist eine der Wiegen unserer Zivilisation. Der Ausgangspunkt zu einer Welt, die auf jenen Werten beruht. Blickt man heute auf diesen Staat, so vermag man fast nicht mehr daran glauben. Marodierende Chaoten, die Athen oder Saloniki in regelmäßigen Abständen verwüsten. Ein von Korruption ausgehöhlter Staatsapparat, der sich in allen Ecken des öffentlichen Lebens festgesetzt hat. Ein Land, das mit verbundenen Augen auf den Bankrott zusteuert. Griechenlands Mißwirtschaft gefährdet sowohl den Euro, wie auch die Europäische Union als Ganzes. Die Krise ist hausgemacht. Alleine die Tatsache, daß ein Viertel (!) aller erwerbstätigen Hellenen dank Vetternwirtschaft einen Staatsposten bekleiden, spricht Bände. Zudem werden fast keine Steuern entrichtet. Wie auch, wenn Verwandte in den Finanzbehörden sitzen und den Betrug gegen andere Gefälligkeiten unterstützen? Zustände, die einer Bananenrepublik gleichen. Aber die Griechen sind durchaus erfinderisch. So erschlich man sich die Eintrittskarte in den Euro-Raum mittels gefälschter Bilanzen, die von den langatmigen Eurokraten in Brüssel wohlwollend durch gewunken wurden. Nun, da kein Zahlenjongleur mehr die bittere Wahrheit über den Staatssäckel verschleiern konnte, wurde die EU doch aufmerksam. Und die Dramatik der Lage lässt seit Aufdeckung dieser Missstände keine Wünsche offen. Die Verschuldung ist so enorm, daß es kaum Hoffnung gibt, den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen. Also nahm man Griechenland als ersten desolaten Staat unter den sogenannten Rettungsschirm. Andere folgten. Was für Hellas galt, muss nun auch für sie gelten. Zahlen tut’s der „kleine Mann“ in jenen Staaten, die sich an die Kriterien gehalten und nicht ihre Kohle zum Fenster hinausgeworfen haben. Die Zeche, die in den griechischen Amtsstuben versoffen wurde. Dabei kann es einem schon den Magen umdrehen. Und die Griechen selbst? Die schäumen seitdem vor Wut, da man sie tatsächlich zum Sparen aufgefordert hat. Und schlagen mal wieder alles kurz und klein. „Die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los.“ So schrieb es Goethe im Zauberlehrling. Und so geht es auch der Europäischen Union. Denn man hat es verabsäumt, eine Austrittsstrategie für solche Staaten einzuplanen. In der naiven Hoffnung, alle würden sich an die Spielregeln halten. Die EU ist ein wundervolles Friedensprojekt. Als geschlossener Wirtschaftsraum funktioniert sie leider nicht. Das werden sich über kurz oder lang alle eingestehen müssen, die daran glaubten. Die Tragödie Griechenlands ist dabei, auch unsere zu werden. Und wie immer sind wir den Mächten der alles verschlingenden Finanzwelt ausgeliefert. Eine Krise geht, die andere kommt. Und so ganz nebenbei heizt sich unser Planet auf wie eine Sauna. Wer auf die Zukunft anstoßen will, sollte es vielleicht mit griechischem Wein versuchen. Das hat zumindest etwas Ironie.
Nun, wer schätzt es nicht, das Land an den Gestaden der Ägäis? Die Heimat von Platon, Homer und Sokrates. Die Wirkstätte der Spartaner, Minoer und Makedonier. Das Füllhorn aller Mythologie, die Geburtsstätte der Demokratie und der Olympischen Spiele. Wer mag ihn nicht, den Wein, den Feta, die Oliven? Griechenland ist eine der Wiegen unserer Zivilisation. Der Ausgangspunkt zu einer Welt, die auf jenen Werten beruht. Blickt man heute auf diesen Staat, so vermag man fast nicht mehr daran glauben. Marodierende Chaoten, die Athen oder Saloniki in regelmäßigen Abständen verwüsten. Ein von Korruption ausgehöhlter Staatsapparat, der sich in allen Ecken des öffentlichen Lebens festgesetzt hat. Ein Land, das mit verbundenen Augen auf den Bankrott zusteuert. Griechenlands Mißwirtschaft gefährdet sowohl den Euro, wie auch die Europäische Union als Ganzes. Die Krise ist hausgemacht. Alleine die Tatsache, daß ein Viertel (!) aller erwerbstätigen Hellenen dank Vetternwirtschaft einen Staatsposten bekleiden, spricht Bände. Zudem werden fast keine Steuern entrichtet. Wie auch, wenn Verwandte in den Finanzbehörden sitzen und den Betrug gegen andere Gefälligkeiten unterstützen? Zustände, die einer Bananenrepublik gleichen. Aber die Griechen sind durchaus erfinderisch. So erschlich man sich die Eintrittskarte in den Euro-Raum mittels gefälschter Bilanzen, die von den langatmigen Eurokraten in Brüssel wohlwollend durch gewunken wurden. Nun, da kein Zahlenjongleur mehr die bittere Wahrheit über den Staatssäckel verschleiern konnte, wurde die EU doch aufmerksam. Und die Dramatik der Lage lässt seit Aufdeckung dieser Missstände keine Wünsche offen. Die Verschuldung ist so enorm, daß es kaum Hoffnung gibt, den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen. Also nahm man Griechenland als ersten desolaten Staat unter den sogenannten Rettungsschirm. Andere folgten. Was für Hellas galt, muss nun auch für sie gelten. Zahlen tut’s der „kleine Mann“ in jenen Staaten, die sich an die Kriterien gehalten und nicht ihre Kohle zum Fenster hinausgeworfen haben. Die Zeche, die in den griechischen Amtsstuben versoffen wurde. Dabei kann es einem schon den Magen umdrehen. Und die Griechen selbst? Die schäumen seitdem vor Wut, da man sie tatsächlich zum Sparen aufgefordert hat. Und schlagen mal wieder alles kurz und klein. „Die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los.“ So schrieb es Goethe im Zauberlehrling. Und so geht es auch der Europäischen Union. Denn man hat es verabsäumt, eine Austrittsstrategie für solche Staaten einzuplanen. In der naiven Hoffnung, alle würden sich an die Spielregeln halten. Die EU ist ein wundervolles Friedensprojekt. Als geschlossener Wirtschaftsraum funktioniert sie leider nicht. Das werden sich über kurz oder lang alle eingestehen müssen, die daran glaubten. Die Tragödie Griechenlands ist dabei, auch unsere zu werden. Und wie immer sind wir den Mächten der alles verschlingenden Finanzwelt ausgeliefert. Eine Krise geht, die andere kommt. Und so ganz nebenbei heizt sich unser Planet auf wie eine Sauna. Wer auf die Zukunft anstoßen will, sollte es vielleicht mit griechischem Wein versuchen. Das hat zumindest etwas Ironie.Donnerstag, 31. März 2011
Tod am Südpol
 Wer kennt es nicht? Hermann Melvilles Walfängerdrama „Moby Dick“. Den Kampf zwischen dem Versucher (Moby Dick) und dem Eiferer (Kapitän Ahab). Die Jagd, die von der idyllischen Insel Nantucket in die unendlichen Weiten des Ozeans führte. Und bis auf einen (Ismael), alle ins Verderben riß. Dieser unvergleichliche Roman der Weltliteratur läßt viele Interpretationen zu. Für mich persönlich stellt er eher ein Gleichnis dar. Das Streben nach dem Unbegreiflichen, dem Unfaßbaren, dem jenseits aller Vorstellungskraft liegenden, daß einen hohen Preis fordert. Einen Preis, den viele Pioniere unserer Menschheit haben zahlen müssen. So auch ein gewisser Robert Falcon Scott, dessen Geschichte eine der tragischsten der Neuzeit ist. Berühmt geworden durch das erschütternde Tagebuch, daß Suchmannschaften gefunden haben. Scott machte sich im Jahre 1910 von Southampton aus auf, um als erster Mensch den Südpol zu erreichen. Noch nicht wissend, daß ihm der Entdecker der Nordwestpassage, Roald Amundsen, bereits auf den Fersen war. Während der emotionale Brite auf einer bereits teilerkundeten Strecke sein Glück versuchte, setzte der pragmatische Norweger bei seiner Routenwahl alles auf eine Karte und vertraute auf altbewährte Mittel, die ihm bei früheren Expeditionen schon zum Ziel geführt hatten. Der Engländer erlebte auf dem Weg zum Pol ein Fiasko nach dem anderen. Die mitgebrachten Motorschlitten funktionierten nicht. Die Zugponys verendeten im eisigen Polarklima. Bei Amundsen lief hingegen alles nach Plan. Und kurz vor Weihnachten 1911 erreichte er mit seinen Gefährten und Schlittenhunden das Ziel seiner Träume, während sich Scott mit seinen Leuten bereits zu Fuß fortbewegen mußte. Und einen Monat später völlig entkräftet die norwegischen Flaggen am Pol erblickte. Von da an wußte er, daß er hier sterben würde. Und so kam es auch. Nach gnadenlosen Gewaltmärschen durch Schneestürme kam die Expedition schließlich zum Erliegen. Und ergab sich ihrem Schicksal. Ganze 18 Kilometer vom rettenden Vorratsdepot entfernt. Noch heute treibt es mir die Tränen in die Augen, wenn ich die letzten Tagebucheinträge des britischen Offiziers lese. Der Südpol wurde zu Scotts „Moby Dick“. Doch sein heroischer Kampf rührte die Menschen. Bis heute. Niemals wieder blieb ein „Zweiter“ so eindrucksvoll im Gedächtnis wie Robert F. Scott. Auf jeder Karte der Antarktis steht sein Name gleich neben dem von Amundsen. Sozusagen als ewiger Tribut. Und der Norweger? Es gab nicht Wenige, die ihn persönlich für Scotts Tod verantwortlich machten. Was natürlich Quatsch ist. Doch der Makel blieb. Trotz seiner zahllosen weiteren Erfolge in den Extremregionen unserer Erde. So gesehen war Scott Amundsens „Moby Dick“.
Wer kennt es nicht? Hermann Melvilles Walfängerdrama „Moby Dick“. Den Kampf zwischen dem Versucher (Moby Dick) und dem Eiferer (Kapitän Ahab). Die Jagd, die von der idyllischen Insel Nantucket in die unendlichen Weiten des Ozeans führte. Und bis auf einen (Ismael), alle ins Verderben riß. Dieser unvergleichliche Roman der Weltliteratur läßt viele Interpretationen zu. Für mich persönlich stellt er eher ein Gleichnis dar. Das Streben nach dem Unbegreiflichen, dem Unfaßbaren, dem jenseits aller Vorstellungskraft liegenden, daß einen hohen Preis fordert. Einen Preis, den viele Pioniere unserer Menschheit haben zahlen müssen. So auch ein gewisser Robert Falcon Scott, dessen Geschichte eine der tragischsten der Neuzeit ist. Berühmt geworden durch das erschütternde Tagebuch, daß Suchmannschaften gefunden haben. Scott machte sich im Jahre 1910 von Southampton aus auf, um als erster Mensch den Südpol zu erreichen. Noch nicht wissend, daß ihm der Entdecker der Nordwestpassage, Roald Amundsen, bereits auf den Fersen war. Während der emotionale Brite auf einer bereits teilerkundeten Strecke sein Glück versuchte, setzte der pragmatische Norweger bei seiner Routenwahl alles auf eine Karte und vertraute auf altbewährte Mittel, die ihm bei früheren Expeditionen schon zum Ziel geführt hatten. Der Engländer erlebte auf dem Weg zum Pol ein Fiasko nach dem anderen. Die mitgebrachten Motorschlitten funktionierten nicht. Die Zugponys verendeten im eisigen Polarklima. Bei Amundsen lief hingegen alles nach Plan. Und kurz vor Weihnachten 1911 erreichte er mit seinen Gefährten und Schlittenhunden das Ziel seiner Träume, während sich Scott mit seinen Leuten bereits zu Fuß fortbewegen mußte. Und einen Monat später völlig entkräftet die norwegischen Flaggen am Pol erblickte. Von da an wußte er, daß er hier sterben würde. Und so kam es auch. Nach gnadenlosen Gewaltmärschen durch Schneestürme kam die Expedition schließlich zum Erliegen. Und ergab sich ihrem Schicksal. Ganze 18 Kilometer vom rettenden Vorratsdepot entfernt. Noch heute treibt es mir die Tränen in die Augen, wenn ich die letzten Tagebucheinträge des britischen Offiziers lese. Der Südpol wurde zu Scotts „Moby Dick“. Doch sein heroischer Kampf rührte die Menschen. Bis heute. Niemals wieder blieb ein „Zweiter“ so eindrucksvoll im Gedächtnis wie Robert F. Scott. Auf jeder Karte der Antarktis steht sein Name gleich neben dem von Amundsen. Sozusagen als ewiger Tribut. Und der Norweger? Es gab nicht Wenige, die ihn persönlich für Scotts Tod verantwortlich machten. Was natürlich Quatsch ist. Doch der Makel blieb. Trotz seiner zahllosen weiteren Erfolge in den Extremregionen unserer Erde. So gesehen war Scott Amundsens „Moby Dick“.
Montag, 21. Februar 2011
Thomas Sankara
 Werfen wir einen Blick auf Westafrika. Da gab es einst einen Staat namens Obervolta. Und einen Revolutionär. Sein Name war Thomas Sankara. Niemand kennt ihn? Kein Wunder. Weil die ehemalige Schutzmacht Frankreich unter dem damaligen Präsidenten Francois Mitterand kein allzu großes Aufsehen wollte, als eine ehemalige Kolonie aus der Reihe tanzte. Die Änderung des Staatsnamens Obervolta in Burkina Faso war erst der Anfang. Sankara, als rechtmäßig gewählter Präsident, der in einem kärglichen Bau unter seinen Mitmenschen wohnte, forderte Rechenschaft von der Grande Nation. Und die antwortete ihm standesgemäß. Indem sie ihm seinen ehemaligen Wegbegleiter Blaise Campoare auf dem Hals hetzte, der ihn schließlich liquidierte und seitdem (1987) unangefochtener Herrscher des Landes ist. Burkina Faso war der erste westafrikanische Staat, der sich gegen die Jahrhunderte lange Sklavenpolitik der Franzosen aufgelehnt hatte. Mit einem Menschen als Schirmherrn, der sowohl hochintelligent als auch grundanständig war. Eine Kombination, die wir seitdem unter Afrikas Herrschern vermissen. Thomas Sankara. Ich sehe heute die Amateuraufnahmen aus Kairo vor mir, wo er für ein Afrika plädierte, dass nicht länger Sklave Europas, der Weltbank oder des Imperialismus war. Wenig später war die „Insubordination“ vorbei. Frankreich (streitet das natürlich ab) unterstützte die freundliche Sklavenpolitik Sankaras Widersacher und ließ ihn durch dessen eigene Hand ermorden. Ich unterstelle nicht nur, nein, ich weiß, dass man Westafrika sukzessive fertig macht. Mit Gammelfleischimporten aus der EU, die dank der beschämenden Armut in diesen Ländern immer noch angenommen werden. Und damit den letzten Rest an heimischer Wirtschaft zerstören. Staaten wie Frankreich glänzen mit politischer Förderung totalitärer Systeme in dieser Region. Stets mit irgendeinem Deckmäntelchen bewaffnet. Um den Fluss an spottbilligen Diamanten ja nicht abreißen zu lassen. Um mit Tod und Ausbeutung Profit zu machen. Thomas Sankara ist lange tot. Und mit ihm starb auch Westafrika. Inklusive seiner Menschen, für die ich heute beten möchte.
Werfen wir einen Blick auf Westafrika. Da gab es einst einen Staat namens Obervolta. Und einen Revolutionär. Sein Name war Thomas Sankara. Niemand kennt ihn? Kein Wunder. Weil die ehemalige Schutzmacht Frankreich unter dem damaligen Präsidenten Francois Mitterand kein allzu großes Aufsehen wollte, als eine ehemalige Kolonie aus der Reihe tanzte. Die Änderung des Staatsnamens Obervolta in Burkina Faso war erst der Anfang. Sankara, als rechtmäßig gewählter Präsident, der in einem kärglichen Bau unter seinen Mitmenschen wohnte, forderte Rechenschaft von der Grande Nation. Und die antwortete ihm standesgemäß. Indem sie ihm seinen ehemaligen Wegbegleiter Blaise Campoare auf dem Hals hetzte, der ihn schließlich liquidierte und seitdem (1987) unangefochtener Herrscher des Landes ist. Burkina Faso war der erste westafrikanische Staat, der sich gegen die Jahrhunderte lange Sklavenpolitik der Franzosen aufgelehnt hatte. Mit einem Menschen als Schirmherrn, der sowohl hochintelligent als auch grundanständig war. Eine Kombination, die wir seitdem unter Afrikas Herrschern vermissen. Thomas Sankara. Ich sehe heute die Amateuraufnahmen aus Kairo vor mir, wo er für ein Afrika plädierte, dass nicht länger Sklave Europas, der Weltbank oder des Imperialismus war. Wenig später war die „Insubordination“ vorbei. Frankreich (streitet das natürlich ab) unterstützte die freundliche Sklavenpolitik Sankaras Widersacher und ließ ihn durch dessen eigene Hand ermorden. Ich unterstelle nicht nur, nein, ich weiß, dass man Westafrika sukzessive fertig macht. Mit Gammelfleischimporten aus der EU, die dank der beschämenden Armut in diesen Ländern immer noch angenommen werden. Und damit den letzten Rest an heimischer Wirtschaft zerstören. Staaten wie Frankreich glänzen mit politischer Förderung totalitärer Systeme in dieser Region. Stets mit irgendeinem Deckmäntelchen bewaffnet. Um den Fluss an spottbilligen Diamanten ja nicht abreißen zu lassen. Um mit Tod und Ausbeutung Profit zu machen. Thomas Sankara ist lange tot. Und mit ihm starb auch Westafrika. Inklusive seiner Menschen, für die ich heute beten möchte.Dienstag, 1. Februar 2011
Der tiefe Fall Justitias
In erschreckender Regelmäßigkeit erreichen uns Meldungen über schwere, teils unfaßbar schreckliche Verbrechen, die inmitten unserer Gesellschaft stattfinden. Es ist müßig, sie alle aufzuzählen. Anhand eines dreijährigen Jungen, der kürzlich zu Tode geprügelt wurde, erkennt auch der Blindeste unter den Blinden, wie sich unsere Rechtspflege heutzutage darstellt. Der pragmatische, logisch denkende Mensch wird im Begriff Gesetz eine Ansammlung von Regeln sehen, die zum Schutz des Individuums vor zugefügten Schaden aufgestellt wurden. Betrachtet man die gängige Praxis, gewinnt man eher einen gegenteiligen Eindruck. Denn längst stehen nicht die Interessen des Opfers im Vordergrund, sondern jene des Täters. Und je grausamer sich das Verbrechen ausnimmt, desto angestrengter begibt man sich auf vermeintliche Ursachensuche, die dann seitens der Verteidigung ausgiebig ins Feld geführt wird. Das treibt teilweise kuriose Blüten. So versucht der Rechtsanwalt in oben angeführten Fall ernsthaft Zweifel an der Tatabsicht seines Mandanten zu streuen, da dieser über eine „Muskelkrankheit“ verfüge und dadurch seine Schläge nicht kontrollieren konnte. Eine solche Argumentation ist unfaßbar, weil sie das Opfer ein zweites Mal tötet. Es erscheint unbegreiflich, mit welch obskuren Mitteln versucht wird, die Taten von Mördern, Vergewaltigern und Kinderschändern zu rechtfertigen. Wer seinen Beruf auf diese Art und Weise ausübt bereitet nicht nur sich selbst Schande. Er macht sich auch zum Mittäter. Und gefährdet unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten. Wie widerlich gerade dieser Fall ist beweißt auch die Rolle, die sogenannte Ärzte und Gutachter eingenommen haben. Nach dessen Festnahme verstieg man sich nämlich dazu, dem Täter tagelang Vernehmungsunfähigkeit zu attestieren. Fassen wir die Fakten zusammen, ergibt sich folgendes, schauerliches Bild. Ein dreijähriger Junge wird über Stunden von seinem Peiniger verprügelt, bis er tot zusammenbricht. Daraufhin flüchtet der Delinquent, wird gefaßt und ist laut Gutachten plötzlich nicht in der Lage, Fragen zum Tathergang zu beantworten. Ein profilierungssüchtiger Pflichtverteidiger sieht seine Stunde gekommen und konstruiert eine Krankheit, die das Verbrechen rechtfertigt. Fortsetzung folgt. Diese Analyse beweißt, wie rasch sich Menschen gefunden haben, die aus eigenem Interesse heraus Kumpanei mit einem Verbrecher betreiben. Unter dem schützenden Schirm des Gesetzes, das längst zum mißbrauchten Handlanger des Bösen mutiert ist. Für das Opfer ist da freilich kein Platz mehr. Nein, es verschwindet zunehmend aus der Wahrnehmung. Übrig bleibt die häßliche Fratze des Mörders, der irgendwann im Laufe des Prozesses wohl kein Mörder mehr sein wird. Und das Grinsen eines selbstzufriedenen Rechtsanwaltes der sich die ruhmvolle Heldentat zuschreiben kann, alles unternommen zu haben, um einen solchen Menschen wieder auf die Gesellschaft loszulassen. Studien belegen, daß durch höhere Strafen die Kriminalität nicht sinken würde. Dafür mag die USA durchaus ein Beispiel sein. Doch darum geht es nicht. Es geht um Schuld und Sühne. Es geht darum, dem Opfer zumindest symbolisch Gerechtigkeit zu verschaffen. Nicht darum, dem Täter eine Zukunft zu ermöglichen. Für die Angehörigen muß es wie ein Hohn sein festzustellen, daß der Mörder des Sohnes, der Tochter oder des Ehepartners nach fünf Jahren wieder frei herumläuft, während einem selbst nur ein nackter Grabstein geblieben ist. Gewiefte Rechtsverdreher, weltfremde Psychologen und unfähige Richter sitzen heute genauso mit dem Finger am Abzug wie die Kreaturen, die sie tagtäglich rauspauken, falschbegutachten und fehlbeurteilen. Treten im Einklang mit dem Täter zynisch auf die geschändeten Opfer ein. Die Justiz hat sich dem Zeitgeist angepaßt. Wendet sich hin zum ausufernden Liberalismus, der keine Moral und keine Gerechtigkeit mehr kennt. Nur noch Toleranz um jeden Preis. Auch um den Preis unserer Sicherheit. Um den Preis unser aller Leben.
Montag, 31. Januar 2011
Pitcairn - lebend oder tot
Abonnieren
Posts (Atom)